Krebsregister kommt später als geplant
Im Parlament war das Vorhaben grösstenteils unbestritten: Krebserkrankungen sollen in Zukunft schweizweit vollständig und einheitlich erfasst werden. Das Potenzial eines nationalen Registers sei gross, befand die Mehrheit. Auch bei Krankenkassenverbänden, Patientenschützern und dem Ärzteverband FMH stiessen die Pläne auf Wohlwollen.
Kritik an Kosten-Nutzen-Verhältnis
Widerstand kam aber aus verschiedenen Kantonen. Einzelne warnten vor "teuren Datenfriedhöfen". Die Regierung schiesse über das eigentliche Ziel hinaus, lautete der Tenor in der Vernehmlassung.
Bedenken gibt es auch hinsichtlich der höheren Kosten, die den Kantonen aus den Zusatzaufgaben erwachsen könnten. Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) schätzt den finanziellen Mehraufwand für die Registrierung auf knapp 20 Prozent. Gegenüber dem erwarteten Nutzen seien die Kosten zu hoch.
2020 statt 2019
Diese Kritik hat der Bundesrat zur Kenntnis genommen. Zwar hat er inhaltlich keine Änderungen an der Krebsregistrierungsverordnung (KRV) vorgenommen. Anders als vor einem Jahr dargelegt, will die Regierung den Kantonen für die Einführung aber mehr Zeit geben.
Die Bestimmungen treten auf den 1. Januar 2020 in Kraft, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Geplant gewesen war eine Einführung per Anfang 2019. Die Verschiebung ermögliche den Kantonen und den kantonalen Krebsregistern, sich auf das neue System der Krebsregistrierung vorzubereiten.
Kantone zahlen
Mit dem Register sollen Krebserkrankungen einheitlich registriert werden. Die Registrierung von Krebserkrankungen baut auf dem bestehenden, dezentralen System auf. Die Fälle werden in den kantonalen Krebsregistern und im Kinderkrebsregister erfasst.
Auf nationaler Ebene werden die Daten anschliessend durch die nationale Krebsregistrierungsstelle zusammengeführt und aufbereitet. Um auf nationaler Ebene über vollzählige Daten zu verfügen, wird für Spitäler, Ärztinnen und Ärzte eine Meldepflicht eingeführt.
In einem jährlichen Krebsmonitoring und in vertiefenden Berichten werden diese dann ausgewertet. Die Register werden weiterhin von den Kantonen finanziert.
Patienten haben Vetorecht
Die Verordnung regelt die Meldung und Erfassung der Daten. Von jeder Krebserkrankung werden einheitliche Basisdaten registriert. Dazu gehören die Art und das Stadium der Krebserkrankung sowie die Erstbehandlung.
Bei Brust-, Prostata- oder Darmkrebs werden Zusatzdaten zu Veranlagungen sowie Vor- und Begleitkrankheiten erfasst, bei Kindern und Jugendlichen detaillierte Angaben zum gesamten Verlauf der Krankheit, deren Behandlung und zur Nachsorge.
Patientinnen und Patienten müssen von einer Ärztin oder einem Arzt mündlich und schriftlich über ihre Rechte, den Datenschutz und über Art, Zweck und Umfang der Datenbearbeitung informiert werden. Sie können der Registrierung ihrer Daten jederzeit widersprechen.
Kein Geld für weitere Register
Pro Jahr werden in der Schweiz mehr als 40'000 neue Krebsfälle diagnostiziert, fast 17'000 Menschen sterben jährlich an Krebs. Gemäss Schätzungen des Bundesamts für Statistik werden aufgrund der demografischen Entwicklung die durch Krebs bedingten Todesfälle in den nächsten zwanzig Jahren um rund ein Drittel zunehmen.
Für andere stark verbreitete oder bösartige nicht übertragbare Krankheiten, wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes, sieht das Krebsregistrierungsgesetz ebenfalls die Möglichkeit für eine finanzielle Unterstützung entsprechender Register vor. Der Bundesrat verzichtet aber vorderhand darauf, hierfür Mittel bereit zu stellen. (sda)
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben
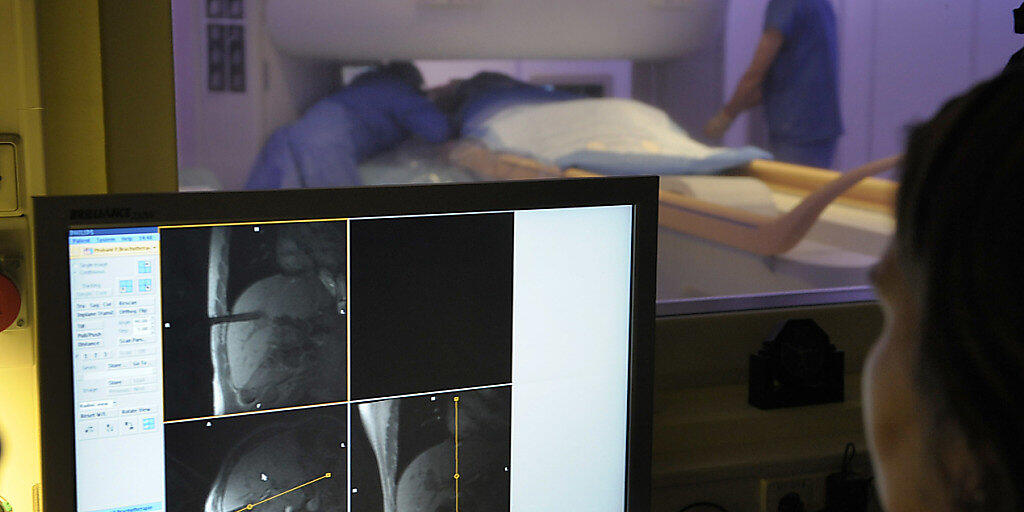

Kleines Vademecum für Kommentarschreiber
Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.
Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.
Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.
Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.
Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.
Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.
Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.
Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.
Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.
Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.
Redaktion Vaterland.li
Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.